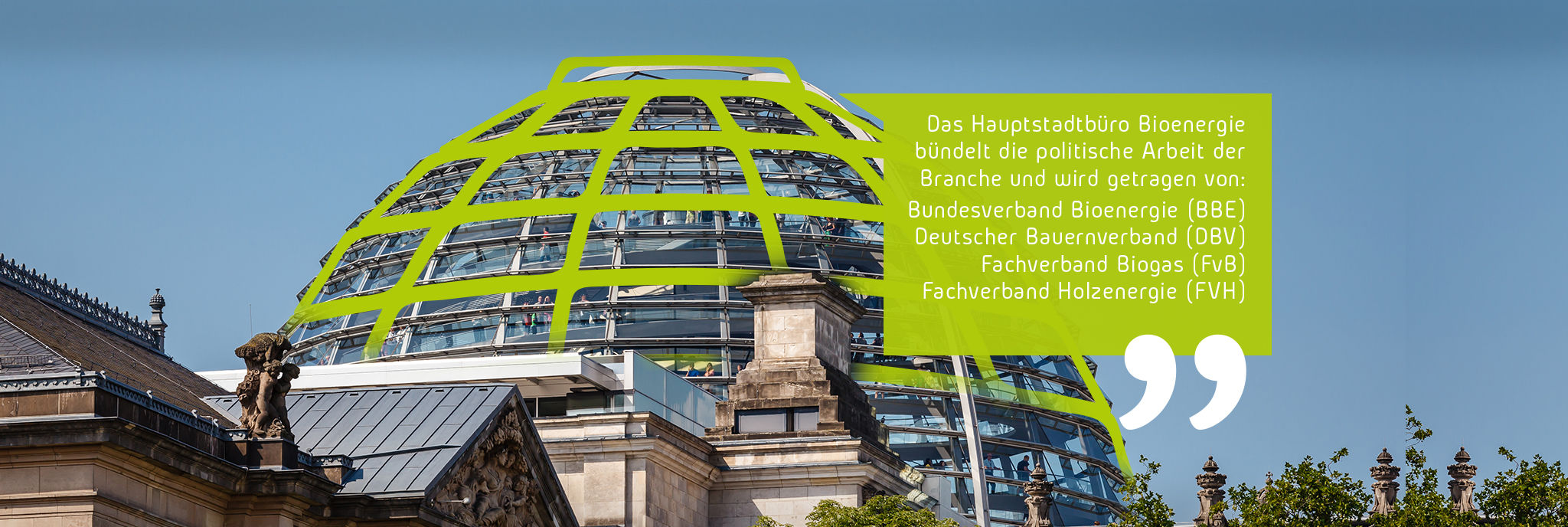Kurzfristiger Anpassungsbedarf: Biomassepaket 2.0 zur Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023)
Das Wichtigste in Kürze
Vor dem Hintergrund steigender Herausforderungen setzen die Maßnahmen des Biomassepakets wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Bioenergie im Stromsektor. Um die EEG-Regelungen im Sinne einer dezentralen, flexiblen und wirtschaftlich tragfähigen Strom- und Wärmeerzeugung weiterzuentwickeln, sehen die Bioenergieverbände jedoch dringenden kurzfristigen Handlungsbedarf. Ziel muss es sein, bestehende Anlagen zu sichern, neue Investitionen wie die Flexibilisierung anzureizen und die Potenziale aller Bioenergieträger zum Zweck einer resilienten, versorgungssicheren Energieinfrastruktur gezielt zu stärken. Die nachfolgenden Vorschläge zeigen auf, an welchen Stellen dafür kurzfristig nachgesteuert werden sollte.
1. Neuen und bestehenden Biogasanlagen, die in die EEG-Anschlussvergütung wechseln, muss wieder mehr betriebswirtschaftliche Freiheit in der Ausgestaltung ihres Anlagenkonzepts gegeben werden. Gleichzeitig muss es weiterhin geeignete Leitplanken für eine Überbauung und flexible Fahrweise geben. Wir schlagen deshalb für Biogasanlagen eine neue Vergütungssystematik vor: Das Strommengenmodell.
• Vergütungsfähige Strommenge: Die Vergütung für Biogasanlagen in den Biomasse-Ausschreibungen wird nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl an Betriebsviertelstunden pro Jahr und auch nicht mehr auf einen Zeitraum von 12 Jahren beschränkt. Vielmehr wird für jede Anlage eine vergütungsfähige Strommenge festgelegt, die grundsätzlich über einen beliebig langen Zeitraum genutzt werden kann. Dies sorgt für einen großen betriebswirtschaftlichen Spielraum zur Ausgestaltung des Anlagenkonzepts und belohnt gleichzeitig eine flexible Stromproduktion.
• Leitplanken für Flexibilität: Zudem werden zum einen eine jährliche Obergrenze festgelegt, welche Strommenge pro Jahr maximal vergütet wird; zum anderen wird ein jährlich sinkender Pfad von maximalen Einspeisestunden bestimmt. Dies garantiert eine flexible Fahrweise.
• Eine Bagatellgrenze schützt Kleinanlagen vor unverhältnismäßigen Anforderungen.
• Die Einführung von „Sondermonaten“ für die Jahre 2025-2027 gibt Bestandsanlagen, deren erster EEG-Vergütungszeitraum ausläuft, ausreichend Spielraum, um Investitionen in ein zukunftsfähiges Anlagenkonzept zu tätigen.
• Die Einführung des Konzepts der „Erneuerungsanlagen“ ermöglicht Bestandsanlagen, in das Strommengenmodell zu wechseln.
2. Mit weiteren Maßnahmen werden die Rahmenbedingungen in den Biomasse-Ausschreibungen verbessert und auf eine effiziente und flexible Strom- und Wärmeerzeugung ausgerichtet:
• Der Maisdeckel sollte gestrichen, mindestens aber an die analoge Regelung im Gebäudeenergiegesetz angeglichen werden.
• Das Ausschreibungsvolumen muss deutlich angehoben und bis 2032 verlängert werden.
• Alle Höchstwerte, anzulegende Werte und bestehende Vergütungsansprüche sollten deutlich erhöht und die Höchstwerte gesetzlich festgeschrieben werden,
• Bei den Biomasse-Ausschreibungen sollten auch Anlagen, die Prozesswärme für industrielle Anwendungen bereitstellen, sowie BECCS- und Biochar-Anlagen bevorzugt bezuschlagt werden.
• Der Flexibilitätszuschlag sollte auf 120 Euro/kW angehoben werden; im Sinne eines Investitionsausgleichs auch für bereits bezuschlagte Anlagen.
• Netzbetreiber sollten zum Angebot einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung verpflichtet werden.
• Biomethan sollte wieder als vergütungsfähiger Brennstoff zugelassen werden
• Die Begrenzung der Vergütung im zweiten Vergütungszeitraum sollte gestrichen oder zumindest klargestellt werden.
• Die EEG-Sanktionen bei verspäteter, fehlerhafter oder fehlender Nachhaltigkeitszertifizierung müssen verhältnismäßig ausgestaltet werden; es darf zu keinem dauerhaften Verlust des NawaRo-Bonus kommen.
3. Daneben müssen insbesondere im Sinne der Akteursvielfalt die Rahmenbedingungen für Kleinanlagen deutlich verbessert werden:
• Die Anschlussregelung für Kleinanlagen in der EEV sollte verlängert und umfassend aufgewertet werden (u.a. Anhebung der Vergütungssätze; Ausweitung der zulässigen Einsatzstoffe; Downsizing zulassen), um Kleinanlagen eine Perspektive zu bieten, für die das Ausschreibungsverfahren keine geeignete Lösung darstellt.
• Der Zuschlag für Kleinanlagen sollte verlängert und erhöht werden, um den spezifischen Kosten von Kleinanlagen gerecht zu werden
• Mit einem neuen Zuschlag für ökologisch besonders wertvolle Substrate sollten Ökosystemdienstleistungen honoriert werden.
• Die Sondervergütungsklasse für Güllekleinanlagen sollte weiterentwickelt werden (u.a. Obergrenze auf 150 kW Bemessungsleistung erhöhen, Anhebung der Vergütung, Ausweitung des Substratspektrums) mit der Option für Bestandsanlagen, in die weiter-entwickelte Klasse zu wechseln.